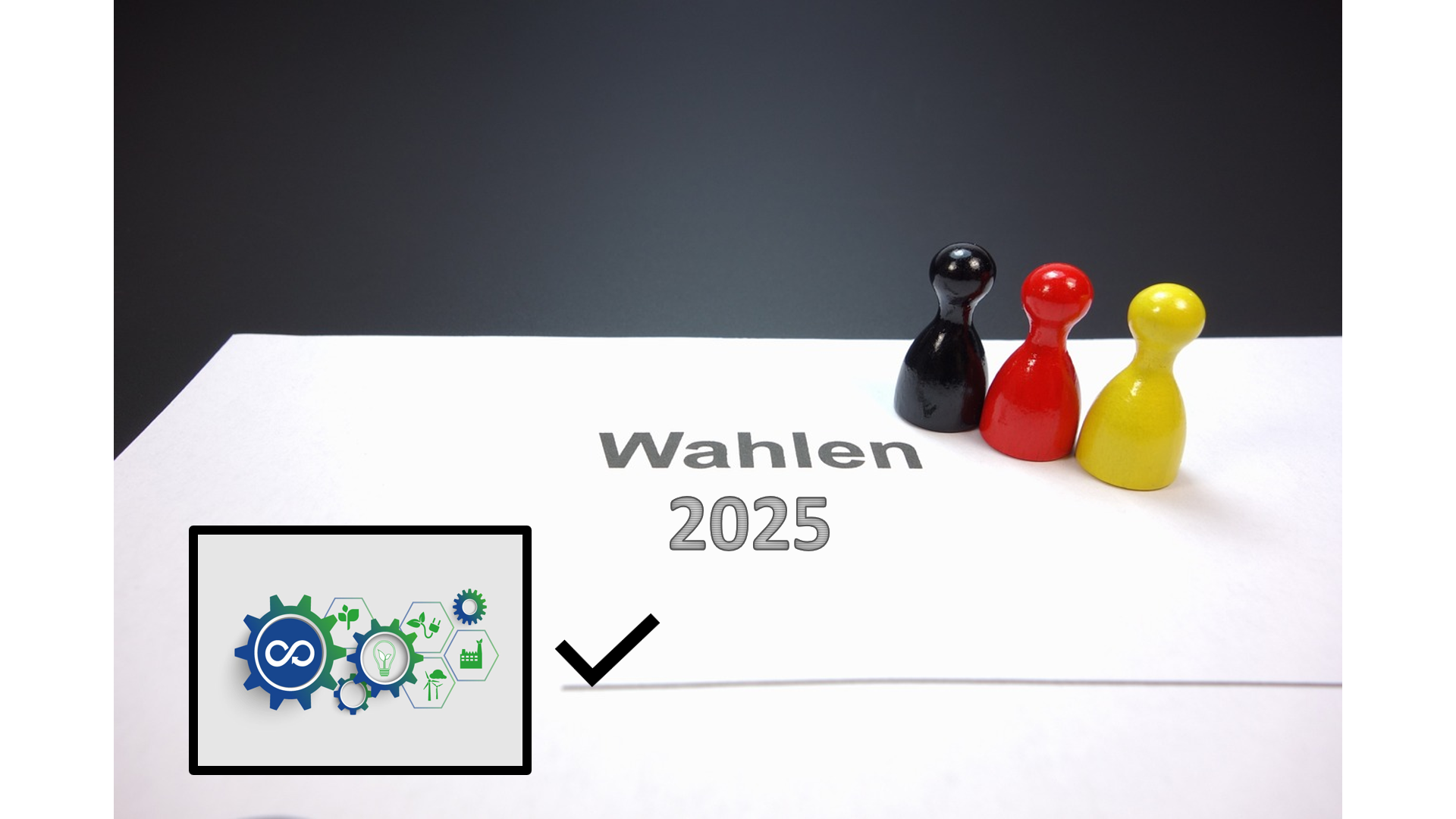
Raphaela Kell: Nach der Bundestagswahl: Mit lokalen Allianzen und zirkulärer Wirtschaft den nachhaltigen Wandel retten – Ein Bottom-up-Katalysator für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft
Die jüngste politische Entwicklung in Deutschland und Europa lässt erahnen, dass eine der drängensten Herausforderungen unserer Zeit – der Klima- und Umweltschutz – in der politischen Agenda der neuen Bundesregierung massiv an Bedeutung verlieren könnte. Zudem gewinnen nicht nur in Deutschland, sondern europa- wie auch weltweit, rechtspopulistische Parteien, die den menschengemachten Klimawandel leugnen oder seine Dringlichkeit herabspielen, zunehmend an Einfluss.
Auch das aktuell von der EU-Kommission vorgestellte sogenannte „Omnibus-Paket“, zur Verringerung des Bürokratieaufwands für Unternehmen, läßt erahnen, dass die politischen Signale Richtung Abbau von Sozial- und Umweltstandards gestellt werden.
Es ist zu erwarten, dass eine Bundesregierung unter Federführung des neuen Bundeskanzlers sich eher auf wirtschaftliches Wachstum im neoliberalen Sinne konzentrieren wird, anstatt eine progressive wirtschaftliche Transformation voranzubringen, die effektiv helfen könnte, die Klima- und Umweltschutzziele weiterhin einzuhalten. In Friedrich Merz´ ökonomischer Paradigmenwelt schließen sich Umwelt- und Klimaschutz und eine zukunftsfähige Wirtschaft wahrscheinlich weitgehend aus, wenngleich bereits viele Unternehmen auch die mittel- bis langfristigen Vorteile einer ökologischen Transformation der Energie- und Industrielandschaft erkennen und sich für diese Transformation aussprechen. Klare Vorteile der Fortsetzung der ökologischen Transformation unserer Wirtschaft sind nicht nur der Schutz unserer Umwelt und des globalen Klimas sondern insbesondere auch ein dringend benötigter Innovationsschub in einer überalterten Industrielandschaft sowie neue umweltverträgliche Wachstums-Perspektiven mit der Aussicht auf sinkende Energiekosten, wenn wir mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und -lieferanten erlangen könnten.
Für viele, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen, ist die momentane politische Stimmungslage besorgniserregend. Aber anstatt in Resignation zu verfallen, sollte dies als Ansporn dienen, neue Strategien und Bündnisse zu entwickeln, um unabhängig von politischen Großwetterlagen nachhaltige Transformationsprozesse und gleichzeitig einen umwelt- und klimagerechten Wohlstand zu entwickeln.
Insbesondere kommunal organisierte Bündnisse hätten den entscheidenden Vorteil, dass sie weniger von wechselnden Regierungen und ihren ökonomischen Richtungsvorgaben und Bundesgesetzen abhängig sind. Gerade auf der kommunalen Ebene, wo sich Akteure oft persönlich kennen und Netzwerke enger und vertrauensvoller geknüpft sind, können tragfähige und resilient agierende Strukturen geschaffen werden, die zukunftsweisende Weichen für einen gelingenden Umwelt- und Klimaschutz als Katalysator für eine nachhaltige Wirtschaft in den Regionen stellen können. Die regional erfolgreich umgesetzten Transformationsstrategien können dann als Blaupause für andere Regionen und Städte dienen und im besten Fall einen positiven wirtschaftspolitischen Kaskadeneffekt auslösen.
Eine der effektivsten Hebel für eine resliente, eigenständige und zukunftsweisende Transformation ist der strategische Aufbau kommunaler Kreislaufwirtschaftssysteme (CE-Hubs).
Kommunale Kreislaufwirtschaft: Ein Schlüssel für nachhaltige Transformation
Ein wirksames Mittel, um unabhängig von politischen Rahmenbedingungen eine nachhaltige Wirtschaftsweise zu etablieren, ist die konsequente Planung und Umsetzung von Kreislaufwirtschaftskonzepten in kommunalen Wirtschafts-Hubs. Kommunal organisierte CE-Hubs ermöglichen eine wirtschaftlich effiziente und umweltschonende Nutzung von Rohstoffen und Ressourcen, indem sie regionale Akteure miteinander vernetzen und industrielle Stoffkreisläufe schließen.
Kommunal organisierte Hubs können den regional ansässigen Unternehmen u.a. dabei helfen:
- Ressourceneffizienzen zu steigern: Durch optimierte Materialkreisläufe werden Abfälle reduziert, Entsorgungskosten minimiert und Rohstoffe in der Region gehalten.
- Lieferkettenprobleme zu vermeiden: Lokale Wertschöpfung reduziert die Abhängigkeit von globalen Märkten und unsicheren Lieferketten.
- Neue wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen: Kreislaufwirtschaft kann ein wirkmächtiger Innovationstreiber für nachhaltige Geschäftsmodelle sein, die Arbeitsplätze sichern und neue Märkte erschließen.
- CO2-Emissionen und Energiekosten drastisch zu senken: Durch lokale Wertschöpfungsketten, Energieversorgungssysteme, und Recyclingstrukturen werden Transportwege minimiert und klimafreundliche Produktionsweisen gefördert.
- Regenerative und widerstandsfähige Wirtschaftssysteme aufzubauen: Unternehmen und Kommunen werden weniger anfällig für Marktverwerfungen und geopolitische Krisen.
Erfolgsfaktoren für wirksame CE-Hubs
Damit kommunale Kreislaufwirtschaftssysteme als resiliente und wirtschaftlich tragfähige Modelle funktionieren, braucht es einige grundlegende Erfolgsfaktoren:
- Interdisziplinäre bzw. transdisziplinäre Zusammenarbeit: strategisch organisierte und umsetzungsstarke CE-Hubs sollten Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen und Zivilgesellschaft eng vernetzen.
- Digitale Infrastruktur und Datenkompetenz: Eine regionale Plattform für Material- und Ressourcenaustausch kann Transparenz schaffen und Effizienz steigern.
- Anpassungsfähige Geschäftsmodelle: Unternehmen müssen wirtschaftlich profitieren, um langfristig Teil des Systems zu bleiben.
- Politische Rückendeckung auf kommunaler Ebene: Auch wenn die Bundespolitik weniger ambitioniert agiert, können Städte und Gemeinden gezielt Anreize setzen.
- Gesellschaftliche Akzeptanz und Mitgestaltung: Bewusstseinsbildung (nachhaltiger Konsum) und aktive Bürgerbeteiligung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg.
Ein wirkungsvoller Ansatz, um Klima- und Umweltschutz unabhängig von politischen Richtungswechseln voranzutreiben, liegt somit in einer engen Kooperation von Wirtschaft, Kommunalpolitik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Diese Akteursgruppen verfügen über entscheidende Kompetenzen und Ressourcen, um systemische Veränderungen anzustoßen und die sich zum Teil bereits transformierende Wirtschaft ggfs. resilient gegenüber rückwärtsgerwandten Politikstrategien zu machen.
Die vorhandene wissenschaftliche Expertise kann hier innovative Lösungen und fundierte Strategien entwickeln, um den Unternehmen die Technologien und Materialien zur Verfügung zu stellen, die sie für innovative, d.h. kreislauffühige Prozesse und Produkte benötigen. Die Wirtschaft kann gleichzeitig ihre Marktkenntnisse, unternehmerische Dynamik und Investitionskraft in die strategische Transformationsplanung einbringen, während die Kommunalpolitik bzw. die Verwaltung die gewünschten wirtschaftlichen Transformationsprozesse gezielt initiiert, koordiniert und steuert. Darüberhinaus können NGOs als gesellschaftliche Katalysatoren positiv auf diesen Prozess einwirken, indem sie Bewusstsein schaffen, Nachfrage nach innovativen ökologischen Produkten generieren helfen und ebenfalls die in der Zivilgesellschhaft seit vielen Jahren gewachsene Expertise im Bereich Umwelt- und Klimaschutz konstruktiv einbringen können.
Fazit: Handeln statt warten
Während politische Entwicklungen oft unvorhersehbar und träge sind, liegt die Handlungsfähigkeit für nachhaltige Transformation längst in den Händen lokaler und regionaler Akteure. Der Aufbau kommunaler CE-Hubs ist eine effektive Möglichkeit, die Wirtschaft nachhaltig zu transformieren, unabhängig von bundespolitischen Entwicklungen. Wenn NGOs, Wissenschaft und Unternehmen und Kommunen gemeinsam Verantwortung übernehmen, kann ein mächtiges Gegengewicht zu klimafeindlichen Tendenzen entstehen – ein resilientes, widerstandsfähiges Netzwerk, das eine nachhaltige Zukunft aktiv gestaltet.
Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam wirksame, selbstbestimmte und wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu schaffen, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch langfristig Stabilität und Wohlstand sichern.