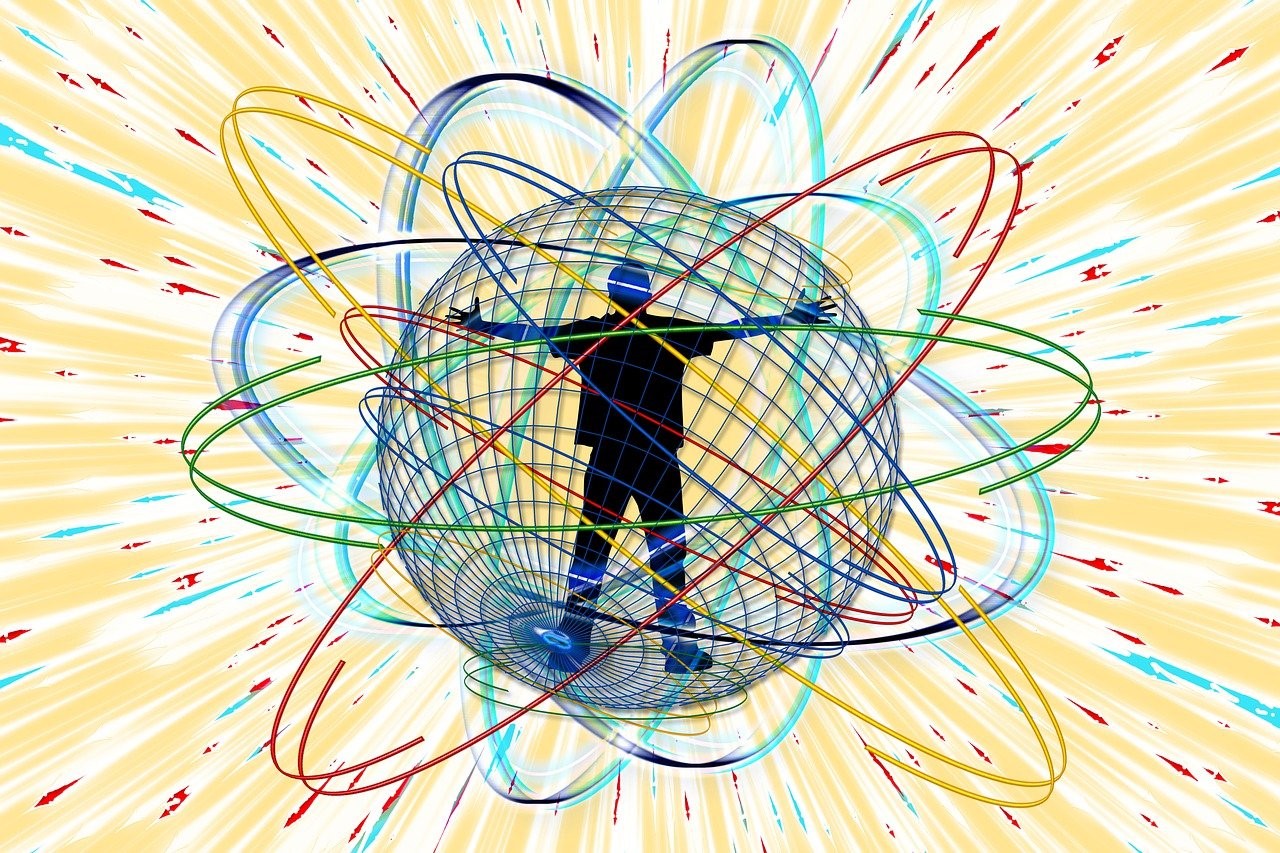
Detlef Baer: Denken wir quantenmechanisch?
Die Quantenmechanik zu verstehen ist ein Unding, selbst für die klügsten Köpfe der Naturwissenschaften. Warum ist das so? Kleine Teilchen wie Photonen können je nach Reihenfolge der Messung entweder als Teilchen gelten oder als Welle. Nils Bohr entdeckte 1928 den Welle -Teilchen- Dualismus. Die Komplementarität – also die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Prozesse oder Darstellungen – besteht aber auch beim menschlichen Denken. In der Welt der Quanten können Objekte in einer Überlagerung mehrerer Zustände existieren, man spricht hier von „Superposition“. Erst mit der Messung erfolgt je nach Reihenfolge die exakte Bestimmung. Im Grunde verhalten sich kleinste Teile irrational, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Festlegung. – Aber passiert nicht Ähnliches im menschlichen Geist?
Auch hier passieren das Gehirn mehrere gleichzeitig vorhandene Entscheidungsmöglichkeiten. Wir kennen das z.B. vom Gefangenendilemma. Zwei Gefangene werden in verschiedenen Räumen befragt, wobei die Polizei jedem unabhängig voneinander folgendes Angebot macht: gestehen beide, gibt es vier Jahre Haft, schweigen beide, so folgen zwei Jahre Haft, gesteht nur einer und der andere schweigt, wird der Geständige freigelassen und der andere für 5 Jahre eingesperrt. Aus der Sicht der Quantenphysik: „In der Vorstellung des Gefangenen kann der andere schweigen oder abtrünnig werden. Jede dieser Möglichkeiten sei wie eine Gedankenwelle. Und wie Wellen aller Art -etwa von Licht, Schall, Wasser – können sie sich gegenseitig stören und sogar auslöschen. Die beiden Neigungen des Spielers -sowohl überlaufen, wenn der Komplize redet, als auch, wenn er schweigt. können sich zum Beispiel gegenseitig aufheben, wenn mit beiden Optionen im Kopf jongliert werden muss. Verstärkt sich allerdings die Gedankenwelle „Der andere wird kooperieren“ im Kopf des Spielers, könne er sich dafür entscheiden, auszupacken.“
Alternative Handlungsweisen sind Bestandteil in der menschlichen Gedankenwelt. Sie entstehen durch Erfahrungen oder auf der Basis von Kenntnissen durchspielbarer Entscheidungsmöglichkeiten. Ist eine Entscheidung vollzogen, dann werden die möglichen Alternativen hinfällig, wie bei Welle oder Teilchen. In der Quantenphysik entscheidet der messende Physiker, welche Entscheidung gilt, wie ist das beim Menschen? Gefühle oder Ratio, was überwiegt? Und: wie vielfältig sind menschliche Abwägungen? Wodurch werden sie beeinflusst, evtl. manipuliert?
Wir kommen mit solchen Fragestellungen sehr schnell in philosophische Grundsatzproblemstellungen. Faszinierend fand ich bei der Lektüre dieses Artikels die Parallelität von Naturvorgängen und synaptischen Vorgängen. Ist die Diversität bei jeglichen Entscheidungen ein von der Natur vorgegebenes Gesetz, so stellt sich die Frage nach dem Wertesystem. Oder regiert die Beliebigkeit als oberstes Ordnungsprinzip?
Warum dieser doch sehr spezifisch anmutende Artikel? Der theoretische Physiker und Sprachwissenschaftler Reinhard Blutner stellte einen Bezug zu echten kognitiven Vorgängen und menschlichem Verhalten her. Er erforscht die epistemische Quantisierung ( von epistéme = Erkenntnis, Wissen) und möchte die Erkenntnisse für die KI nutzen. Ein Beispiel: die Musikpsychologie erkannte, dass für unser Gehör bestimmte Töne besser zueinander passen als andere (sog. Prime -Kontext). Erforscht man, welche internen Repräsentationen auf den tieferen Schichten entstehen (oder entstehen sollen ), ließen sich die mathematischen Strukturen aus der Quantentheorie für die Interpretation der Aktivitäten künstlicher neuronaler Netze auslesen und nutzen. Algorithmen könnten dann auf der Basis der Quantenlogik schneller lernen als klassische neuronale Netze.
„ Mit der Quantenkognition könnten wir KI so gestalten, dass sie in der Lage ist, Perspektiven auszuwählen…Dann hätte der KI – Agent eine Reihenfolge an Präferenzen, die sich aber verändern kann.“
Die oben von mir aufgeführten Fragen nach der Wertigkeit von Entscheidungen finden in den Ausführungen des Aufsatzes keine Beachtung. KI soll dem menschlichen Gehirn möglichst nahekommen, also demnach auch Entscheidungen treffen, die die Menschheit wesentlich beeinflussen könnte. Kein Naturwissenschaftler kann so naiv sein, den Aspekt der Manipulierbarkeit und – vielleicht noch schlimmer- der Vertrauensseligkeit zu missachten. Das Wissen – und darum dieser Artikel – um anstehende Forschungen sollte nicht verborgen bleiben, denn liegt ein Resultat anwendbar vor, ist es meistens zu spät.
[1] Die wesentlichen Informationen dieses Aufsatzes sind dem Artikel „Quantenkognition…“ von Janosch Deeg aus dem Spektrum 1.25, S,.64 ff entnommen [1] Ebenda S.68, zitiert wird die Kognitionswissenschaftlerin Zheng Joyce Wang